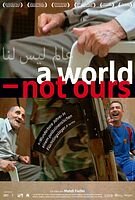
Kinostart: 18.09.2014
Weitab von aktivistischem Agitprop erzählt Mahdi Fleifel ganz intim und überragend die eigene Geschichte, die seiner Freunde und seines Volkes mit über Jahrzehnte gesammelten Privatmaterial und Aufnahmen aus wiederholten Besuchen in dem Lager. Ein reflektiertes Home Video, das bewegend, nachdenklich und sensibel hinter Stereotypen und Ideologisierungen blickt: Ein bedrückendes Porträt des Lebens in schäbigen, engen Gassen.
Fleifel hat sein komplexes Projekt komplett selbst gestemmt und führt als Erzähler durch seine Vergangenheit, enthüllt nach und nach jene der anderen und nebenbei die politische Historie – nicht nur mit Zwischentönen und ungewohnter Perspektive, sondern so subtil eindringlich und amüsiert melancholisch, dass es einen innerlich zerreißt. Er gewann hochverdient den Friedenspreis der Berlinale 2013 und noch viele weitere.
„Wir haben uns selbst ruiniert“ sagt Abu Eyad, bevor er der Fatah, die die unverputzte Betonwüste regiert, den Rücken kehrt. Korruption und Gewalt sind eine Sache, die andere, dass die Menschen weder nach Palästina zurück dürfen noch im Libanon patriiert werden. Sie sind wie Aussätzige ghettoisiert und seit der Nakba – der großen Vertreibung – rechtlos, arbeitslos, unerwünscht. Abu Eyad ist im Libanon geboren und doch heimatlos.
Sie sind Flüchtlinge ohne Land und werden wie Dreck behandelt, schimpft er desillusioniert und ist frustriert über Leute, die sich darin eingerichtet haben, die Realität zu verdrängen. Der Mann, der als Jugendlicher von der Fatah mit Elektroschocks gefoltert wurde, tobt über deren Ignoranz, noch heute Arafat als Verräter für dessen Friedensschluss zu betrachten. Ein Zeugnis trostlosen Stillstands. Nichts ändert sich. Auch nicht im Denken.
Als einer der wenigen sieht er diese Wahrheit und will fort. Seine exemplarische Leidensgeschichte schmerzt unendlich. Neben Mahdis Großvater und dessen zänkischem Mitbewohner Said – einst ein Idol, inzwischen in der Rolle des Dorfidioten und traurigen Clowns verloren – reflektiert der Regisseur über seine eigene Rolle: Er fühlt sich als entfremdeter Außenseiter, als freier Gast bei Gefangenen, die langsam durchdrehen.
Das Disneyland seiner Kindheit ist einfach nur ein hässliches Schlammloch, wo selbst Götzen sterben und noch über Hochzeitsfeiern Wehmut und Adieu liegen. Er denkt nicht nur darüber nach, wie sein Leben wohl aussähe, wenn er das Camp nie verlassen hätte (nach Dubai, Dänemark und London). Als er mit einer Schulreise Israel besucht, bestürzt ihn auch die Verwirrung, sich als Fremder in einem fremden Land zu fühlen.
Im Holocaust-Museum denkt er an die israelische Broken-Bones-Policy und erkennt, dass er – analog zu Abu Eyad – Wünsche hegt, die nie wahr werden und seine Was-wäre-wenn-Träume von der Rückkehr in die Heimat nur Wunden sind, die nie verheilen. So reist er ab, nimmt Abschied von Kindheit und Erinnerungen, Abschied von Palästina, so meisterhaft inszeniert und voller Wehmut, dass diese Doku einfach erschüttert.
